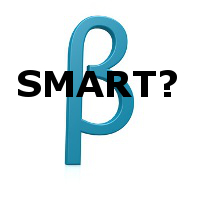„Smart Beta“-Konzepte sind in aller Munde, doch eine allgemeingültige Definition gibt es dafür nicht. „Das Konzept ist ein Resultat aus der langjährigen Debatte über die Vor- und Nachteile von aktivem und passiven Portfoliomanagement“, unterstrich jüngst Christina Böck, CIO Switzerland und Head Solution Strategist Central Europe bei AXA Investment Managers.
Zwischen 1990 und dem Beginn des 21. Jahrhunderts war es üblich, die Performance von Portfolios anhand von Referenzindizes zu messen, in der die jeweiligen Titel analog zu ihrer Marktkapitalisierung gewichtet waren. Da nur wenige Portfoliomanager diese Benchmark über längere Zeiträume übertrafen, sahen sich die Befürworter passiver Strategien in ihrer Position bestärkt. Inzwischen hat sich allerdings bei den meisten Investoren die Einsicht durchgesetzt, dass beide Ansätze ihre Berechtigung haben können – je nachdem, was die Ausrichtungskriterien eines (Teil-)Portfolios sind.
„Als in der großen Krise von 2008 die Nachteile der kapitalisierungsgewichteten Benchmarks deutlich wurden, begann die Finanzbranche über neuartige Indizes nachzudenken“, so Böck. Die Grundfrage: Wie verschafft man den Investoren Zugang zu einer bestimmten Risikoprämie, ohne die Nachteile der traditionellen Indizes zu tragen? Die Antwort darauf sind die so genannten Smart-Beta-Konzepte. „Allerdings gibt es dafür so viele Definitionen wie Asset-Management-Firmen, die es anbieten“, unterstreicht die Investmentexpertin. „Gemeinsam ist diesen Ansätzen in der Regel nur, dass sie auf eine ausgewogenere Gewichtung der Titel abzielen, wobei ausgewogen ein relativer Begriff ist.“
In der jüngeren Vergangenheit haben sich die Kundensegmente in dieser Hinsicht deutlich auseinanderentwickelt. So sind für private Kunden in vielen europäischen Ländern die Total-Return- oder Absolute-Return-Produkte wieder im Vormarsch. Diese Ansätze zielen darauf ab, in allen Marktkonfigurationen eine Performance über Null zu liefern, zumindest über längere Zeitperioden. „Heute sind diese Versprechen allerdings realistischer als in den neunziger Jahren, in denen die ersten Total-Return-Produkte auf den Markt kamen“, betont Böck. „Seither haben sich nicht nur die Risikomanagement-Techniken weiterentwickelt, sondern auch das Angebot an derivativen Produkten. Heute lassen sich nahezu alle Anlageklassen kostengünstig absichern.“ Zudem seien die Schattenseiten dieser Produkte heute besser bekannt, etwa die Tatsache, dass Investoren in Haussezeiten mit etwas weniger Performance rechnen müssten.
Lösungen gefragt
Für institutionelle Kunden finden die neuesten Entwicklungen auf einem ganz anderen Terrain statt. Böck: „Auf Grund von immer mehr und immer komplexerer Regulierung und extrem tiefen Zinsen und Renditen, sind insbesondere die Versicherungsgesellschaften und Pensionskassen immer komplexeren Investitionsanforderungen ausgesetzt.“ So sind sie gezwungen, verschiedenste Auflagen zu erfüllen, die sich zum Teil widersprechen, wie etwa im Fall der Solvenzanforderungen gemäß Solvency II und den Garantiezinsen, die in manchen Ländern sehr hoch sind.
Kleinere Gesellschaften oder Vorsorgeeinrichtungen können nach Einschätzung Böcks nicht mehr Schritt halten: „Oft fehlt es ihnen an den internen Ressourcen, um diese Anforderungen zu bewältigen. Daher delegieren sie Teile ihrer Wertschöpfungskette an externe Dienstleister und werden dies in der Zukunft noch verstärkt tun.“
Aus dieser Entwicklung resultiert ihrer Ansicht nach der Trend zum Wandel vom Produkt- zum Lösungsanbieter, den viele Asset-Management-Firmen derzeit durchlaufen. Bei nahezu allen größeren Adressen entstehen Abteilungen, die den Namen Solutions im Titel tragen und deren Ziel es ist, institutionellen Kunden bei der zielführenden Strukturierung ihrer Investitionen zu beraten. „Dafür sind fundierte Kenntnisse über Regulierung, Buchhaltung, Aktiv-Passiv-Verhältnisse und sonstige Ansprüche der Kunden erforderlich“, unterstreicht Böck. Ihr Fazit: „Der Ansatz ist sicher der richtige – ob wirklich alle Asset Manager diese Expertise mit ausreichender Qualität anbieten können, bleibt abzuwarten.“
Wohin entwickelt sich die „Smart-Beta“-Diskussion?